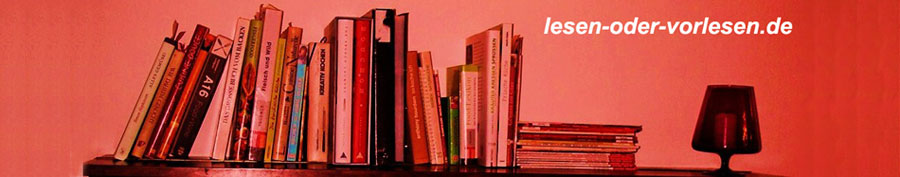|
|

Sonstiges
| | | | | Theatertipp: Life-ToHuWaBoHu ...für immer? | Die Musical-Comedy-Show
von und mit Camilla Kallfaß
Piano: Johannes Söllner
Mit: Jonas Zeiberts
Sonntag, 12. März, 20 Uhr
im Wallgraben Theater Freiburg
Eine Frau. Mann weg. Job weg.
Sie kämpft, steht, fällt – steht wieder auf, singt, tanzt und liebt.
Erleben Sie: Vegetarische Metzgerinnen, lüsterne Gurus, steppende Nonnen, Nutella-süchtige Prostituierte und schüchterne Freier!
Lassen Sie sich mitreißen, berühren und verführen von einer Geschichte mit Drama und Humor. Mit den Hits der letzten 200 Jahre von Pop über Operette bis Afrodance.
“Aufhorchen lässt eine junge Dame, die das Showbiz offenbar mit der Muttermilch eingesogen hat. Camilla Kallfaß ist eine echte Stimmröhre und dazu ein Hingucker auf den Showbrettern, die sie auch tanzend locker durchmisst. Den Namen wird man sich merken.” (Offenbach-Post)
CAMILLA KALLFAß ist Freiburgerin. Sie hat 2004 - 2008 an der Universität der Künste Berlin ein Diplomstudium für Schauspiel, Gesang und Tanz absolviert und mit Auszeichnung abgeschlossen. Seit 2006 ist sie erfolgreich im deutschsprachigen Raum in verschiedenen Produktionen und Theatern auf der Bühne zu sehen. Zu ihrem Repertoire gehören u.a.: die weibliche Hauptrolle Lucy Harris im Musical “Jekyll & Hyde” (u.a. in der Musikalischen Komödie Leipzig und im Staatstheater Cottbus), Manuela in “Vom Wedding nach Las Vegas – Die Manuela-Story” (Kleines Theater am Südwestkorso Berlin u.a.), Gretchen in “Faust- die Rockoper” (Tour), Reno Sweeney in “Anything Goes” (Staatstheater Cottbus), Marion in “Dantons Tod” (Zimmertheater Rottweil), Kitten in “Kauf dir ein Kind” (Neuköllner Oper Berlin).
2015 hatte sie mit ihrer Musical-Comedy-Show „Life-ToHuWaBoHu ... für immer?“ bei den Schönen der Nacht in Freiburg Premiere und 2016 gab sie ihr Debüt im Wallgraben Theater Freiburg mit Sibylle Bergs Theaterstück: „Und jetzt: Die Welt! - Oder: Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen“. (Welches im Februar 2017 wiederaufgenommen wird bzw. wurde). | | Mehr | | | |
| | | | | | Vortrag von Prof. Dr. Dr. Bernhard Uhde | Prof. Dr. Dr. Bernhard Uhde ist Gründer und Direktor des Instituts für interreligiöse Studien Freiburg
"Geächtet" ist eine Komödie über religiöse und ethnische Identität, über Vorurteile in einem vermeintlich weltoffenen Milieu. Ayad Akhtar, der – wie seine Hauptfigur – selbst pakistanische Wurzeln hat, führt ungeniert Klischees vor. Es sind Klischees, die durch unser aller Köpfe spuken, wenngleich einige spezifisch amerikanisch sind. Doch wer glaubt, er sei als Europäer völlig frei von diesen, betrügt sich selbst.
Viele Kritiker haben Akhtar mit Yasmina Reza verglichen. Ähnlich wie diese versteht er es, im boulevardesken Gewand ernste Themen aufzugreifen. "Geächtet" rührt an brisante Fragen, ist ein Stück über im liberalen Bürgertum schwelende Vorurteile, xenophile Romantisierungen und Rassismus, die Fragilität des sozialen Friedens und das, was der Schriftsteller und Psychoanalytiker Sudhir Kakar "Gruppen-Identität" nennt, deren Macht unsere von einem phantasmatischen Individualismus beherrschte Kultur gerne ignoriert.
Montag, 13. März, 20 Uhr
im Wallgrabentheater Freiburg
zu den interreligiösen und kulturellen Fragestellungen in GEÄCHTET von Ayad Akhtar | | | | | |
| | | | | | Theatertipp: Matthias Deutschmann - Wie sagen wir's dem Volk? | Kabarett
Sonntag, 05. März 2017 | 19.00 Uhr
im Vorderhaus Freiburg
"Der Freiburger macht auch nach drei Jahrzehnten ein Edelkabarett, hinter dem nicht nur ein kluger, sondern brillanter Kopf steckt. " (AZ München)
"Wie immer hochintelligentes Polit‐Theater: bitterböse und auch gerne mal hart am Rande der Erträglichkeit, vorgetragen stets mit süffisant‐sonorer Stimme und messerscharf gesetzten Pausen. Einer der auf seine Art schon einzigartig ist. "(Nürnberger Zeitung)
| | Mehr | | | |
| | | | | | Karlsruhe: Meditatives Zeichnen und Entdeckertag | Ab März wieder Veranstaltungen der Waldpädagogik
Die Waldpädagogik Karlsruhe startet in diesen Tagen ihren Veranstaltungsreigen für das Jahr 2017. Den Anfang macht am Freitag, 10. März, eine literarische Vollmondwanderung für Erwachsene. Ab 19 Uhr führt Revierförster und Projektleiter Waldpädagogik Martin Kurz mit Gedichten und Geschichten über Mond, Nacht und Wald rund zweieinhalb Kilometer und etwa zwei Stunden durch sein Revier. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei drei Euro. Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren sind am Freitag, 17. März, von 16 bis 19 Uhr zum Workshop "Zentangle/Zendoodle" willkommen. Sie erlernen unter fachkundiger Anleitung meditatives Zeichnen und lassen dabei den Alltagsstress hinter sich. Inspiration bietet der Wald vor den Toren des Waldklassenzimmers. Zu beiden Veranstaltungen ist Anmeldung bis zwei Tage vorher unter Telefon 0721/133-7354 oder per E-Mail waldpaedagogik@fa.karlsruhe.de notwendig. Interessierte erfahren dann auch den genauen Treffpunkt für die Veranstaltungen.
Gratis ist der erste Entdeckertag rund um das Waldklassenzimmer nahe des Adenauerrings. Familien können am Sonntag, 19. März, von 14 bis 18 Uhr auf dem weitläufigen Gelände forschen und spielen. Zur gleichen Zeit bietet das Waldklassenzimmer eine Holzwerkstatt zum Schnitzen an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können verschiedene Techniken und Holzprodukte testen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Hier fallen allerdings Kosten in Höhe von zehn Euro (Familien: 15 Euro) an. Weitere Infos unter www.waldpaedagogik-karlsruhe.de. Dort gibt es auch eine Anfahrtsskizze. | | Mehr | | | |
| | | | | | Die Publikumslieblinge sind zurück | Küken-Trubel im Museum Natur und Mensch
Für Freunde des flauschigen Hühnernachwuchses ist es ein
jährlicher Pflichttermin: Die beliebte Ausstellung „Vom Ei zum Küken“
im Museum Natur und Mensch lädt von Samstag, 4. März, bis
Sonntag, 23. April, wieder dazu ein, frisch geschlüpfte Küken zu
besuchen und sie beim ersten Picken und Probeflattern zu
bewundern. Die Spannung, ob man den richtigen Moment erwischt
hat und ein Küken beim Schlüpfen beobachten kann, gehört für viele
Stammgäste dazu. Genauso wie die Faszination über das wuselige
Treiben im Kükenhaus, das nun dank einer Spende über einen
modernen Look und ein zusätzliches kleines Schaufenster verfügt.
Bei der Vorbereitung zeigte sich, dass auch die traditionelle KükenSchau
nicht unabhängig von Witterung und Grippewellen ist: So
musste das Organisationsteam zu Jahresbeginn wegen Vogelgrippe,
Kälteeinbruch und dem einen oder anderen Fuchs noch um den
flauschigen Nachwuchs bangen. Doch am Ende ist alles gut
gegangen und so gibt es auch in diesem Jahr wieder besondere und
seltene Hühnerrassen zu entdecken.
Die Familien-Ausstellung beantwortet außerdem spannende Fragen
rund ums Ei: Wie entwickelt sich ein Ei im Huhn? Und wie wächst ein
Küken in seiner Schale heran? Kleine und große Besucherinnen und
Besucher können die Formen- und Farbenvielfalt vom Kolibri- bis
zum Dino-Ei entdecken. In einem weiteren Ausstellungsraum gibt es
faszinierende Infos zur kulturellen und symbolischen Bedeutung von
Eiern auf der ganzen Welt. In Zusammenarbeit mit dem
Freundeskreis Tel Aviv-Yafo ist dort beispielsweise eine neue Vitrine
zum Pessach-Fest entstanden.
Wem die Ausstellung besonders am Herzen liegt, kann in diesem
Jahr wieder gegen eine Spende eine Ei-Patenschaft übernehmen.
Außerdem gibt es ein umfangreiches Angebot an ErlebnisFührungen
für Kindergartengruppen, Schulklassen und Familien.
Küken-Fans können einen Blick hinter die Kulissen werfen oder an
kreativen Nachmittagen bunte mexikanische Konfetti-Eier basteln.
Das Museum Natur und Mensch, Gerberau 32, ist dienstags bis
sonntags und am Ostermontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der
Eintritt kostet 5, ermäßigt 3 Euro, unter 18 Jahren und mit MuseumsPass-Musées
ist er frei. Weitere Informationen zu den ErlebnisProgrammen
unter www.freiburg.de/museen-bildung. | | Mehr | | | |
| | | | | | Pressemitteilung des E-Werk Freiburg e.V. | Wie die Badische Zeitung in ihrer Ausgabe vom 22.02.2017 auf Seite 23 veröffentlicht hat, sieht der Haushaltsvorschlag zum nächsten Doppelhaushalt der Fraktion der Grünen im Freiburger Gemeinderat eine sogenannte „Verschiebung“ oder „Umschichtung“ innerhalb des Kulturhaushaltes vor.
Die Mitarbeiter und auch der Vorstand des E-Werk Freiburg e.V. sehen die haushaltspolitischen Pläne der Grünen-Fraktion im Gemeinderat als ein übles kulturpolitisches Foulspiel an, sie machen uns wütend und ratlos. Der Plan sieht einen Verzicht auf das „Tanz- und Theaterfestival“ und damit finanzielle Kürzungen in Höhe von 182.600,00 € vor, damit fielen auch komplementäre Landesmittel in Höhe von 91.300,00 € weg. Im Gegenzug sollen u.a. zwei von uns geschätzte, langjährige Vereinsmitglieder, das „Theater im Marienbad“ und „Bewegungsart“, aus diesen Mitteln finanziert werden. Hier wird versucht, die Kulturszene gegeneinander auszuspielen. Wir halten diese Idee für fatal, das geht gar nicht. Sind das haushaltspolitische Spielchen oder ist es ein ernstgemeintes Szenario? Hier wird die Arbeit des E-Werk's und seiner Festival-Partner, das Theater Freiburg und das Theater im Marienbad, für wertlos und ohne fachlichen Verstand diskussionslos für streichbar erklärt. Nicht zuletzt fühle ich mich als Vorstand auf der Basis solcher Streichszenarien persönlich außer Stande, den Verein mit meinem geplanten künstlerischen Konzept und einem zusammengestrichenen Etat sinnvoll zu führen.
Für die Mitarbeiter des E-Werk's
Jürgen Eick, geschäftsführender Vorstand | | | | | |
| | | | | | Historix-Tour "GEISTER, SPUK UND WEISSE FRAUEN RELOADED" | Premiere am Samstag, 11. März 2017, 20 Uhr
Treffpunkt: "Am Predigertor", Ecke Rotteckring / Unterlinden
Nachdem wir seit 1999 den Ghost-Walk "Geister, Spuk und weiße Frauen" im Programm hatten und dieser stets von mysteriösen Erscheinungen überschattet wurden, nahmen wir diesen verfluchten Walk im vergangenen November aus dem Programm und ersetzen ihn nun durch eine neue Führung: "Geister, Spuk und weiße Frauen reloaded". Aber ist der Fluch gebrochen? Oder geschehen weiterhin seltsame Sachen während dieser Tour?
Das können Sie ab dem 11. März 2017 erleben ...!
FREIKARTEN:
Für die Historix-Tour "GEISTER, SPUK UND WEISSE FRAUEN RELOADED" am Samstag, 11. März 2017, 20 Uhr, verlosen wir 2 x 2 Frei-Tickets. Um an dieser Verlosung teilzunehmen, bitte bis 6.3. einschreiben. Die Gewinner werden per eMail benachrichtigt und im prolixletter namentlich bekannt gegeben. Viel Glück! | | Mehr | | | |
| | | | | | Historix-Tour "RACHE, GEISTER, ERZRIVALEN" | am Samstag, 4. März 2017, 20 Uhr
Treffpunkt: Aufgang Schwabentorsteg (am Schwabentor)
Als junger Soldat unter König Ludwig XIV. von Frankreich eroberte Henri LeMalheure einst Freiburg - von seinem baldigen Tod hat er sich bis heute aber noch nicht erholt. Reisen Sie mit ihm zurück in die Vaubansche "Festung" und lauschen Sie seinen packenden Berichten, voll von Aberglauben und tragischen Verwicklungen. Dumm nur: Der Geist seines ewigen Widersachers Maurice spukt ebenfalls durch die alten Festungsmauern!
Mit zwei Schauspielern!
FREIKARTEN:
Für die Historix-Tour "RACHE, GEISTER, ERZRIVALEN" am Samstag, 4. März 2017, 20 Uhr, verlosen wir 2 x 2 Freitickets. Um an dieser Verlosung teilzunehmen, bitte bis 1.3. einschreiben. Die Gewinner werden per eMail benachrichtigt und im prolixletter namentlich bekannt gegeben. Viel Glück!
| | Mehr | | | |
|
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237
|
|
|